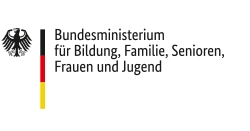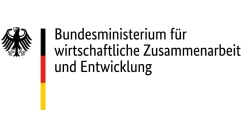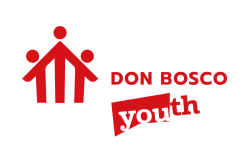Postkolonialismus und Freiwilligendienst: „Glaube ich an eine andere Welt – oder nicht?“
Vor 150 Jahren fand die erste Missionsaussendung der Salesianer Don Boscos statt. 2026 jährt sich außerdem der Todestag von P. Rudolf Lunkenbein zum 50. Mal. Beides lädt dazu ein, die Vergangenheit nicht zu verklären, sondern ehrlich hinzuschauen – und zugleich zu fragen, was davon heute Bedeutung hat. Beim Allerheiligentreffen von Don Bosco Volunteers haben viele ehemalige Freiwillige das in einem Workshop von Benedikt Kern gemeinsam getan: kritisch, offen, mit Respekt vor den eigenen Erfahrungen. Gleichzeitig haben sie sich vom Mut der Missionare inspirieren lassen, die damals aufgebrochen sind – oft mit wenig Gewissheit, aber viel Vertrauen. Mit Benedikt Kern, selbst früher Don Bosco Volunteer, haben wir darüber gesprochen, warum diese Debatte wichtig ist.
Benedikt, du warst selbst Volontär und hast später Theologie studiert. Was aus deiner Freiwilligenzeit wirkt bis heute in deinem Denken und Glauben nach?
In meinem Freiwilligendienst in Abidjan/Elfenbeinküste habe ich erstmals die Erfahrung von Armut, Kolonialismus und eines starken Klassenunterschiedes in meiner unmittelbaren Lebensumgebung gemacht. Das hat mich geprägt und mich seitdem nicht mehr losgelassen, die Frage nach der Möglichkeit globaler Gerechtigkeit zu stellen. Für mich war das auch eine Glaubensfrage: Glaube ich an eine andere Welt – oder nicht? Und was ist dann eine sinnvolle Praxis, die sich auf die Veränderung des Ganzen hin orientiert, wenn kleine Verbesserungen einer „Entwicklungs“-Hilfe den Kern der Probleme einer kapitalistisch organisierten Welt nicht treffen? Diese Fragen treiben mich bis heute um, mittlerweile sogar noch stärker als direkt nach meinem Freiwilligendienst.
In deinem Workshop auf dem Allerheiligentreffen ging es u.a. um Postkolonialismus. Warum ist dieses Thema für Freiwilligendienste – auch rückblickend – heute besonders wichtig?
Als Don Bosco Volunteers sind wir nicht die Retter der armen Straßenkinder. Denn wir kommen aus einem Land, das in die globale Ungerechtigkeit durch die bis heute andauernde Kolonialgeschichte Europas verstrickt ist. Es hilft uns nicht, deshalb mit einem schlechten Gewissen durch die Welt zu laufen, sondern diese Verstrickung fordert uns dazu heraus, uns in ein kritisches Verhältnis zu unserer Gesellschaft zu setzen. Die Erfahrung eines Freiwilligendienstes kann hierfür eine wichtige Anstiftung sein, nicht locker zu lassen, dass die Gewaltverhältnisse mit Kriegen, Grenzabschottung, Umweltzerstörung etc. nicht so bleiben können.
Viele junge Menschen fragen sich, wie Kirche heute glaubwürdig sein kann. Was müsste sich aus deiner Sicht ändern – und wo siehst du Hoffnung?
Die beiden großen Kirchen in Deutschland haben ihr Glaubwürdigkeit verspielt, weil es ihnen mehr um den institutionellen Erhalt als um die Botschaft des Evangeliums – nämlich den Kampf um die Autonomie und Egalität aller und ein Festhalten an einem befreienden Gott – geht. Die Kirchen bemühen sich nun um Anschlussfähigkeit, man wiederholt also das, was überall auch schon gesagt wird, und vermeidet so den Konflikt mit denjenigen, die gesellschaftlich das Sagen haben. So machen es in der Bibel die Hofpropheten, sie sagen, was die Herrschenden von ihnen erwarten, um so ideologisch abgesichert zu werden. Dagegen lehnen sich Jesaja, Jeremia, Ezechiel und andere Propheten in der Bibel auf und sagen: Wir müssen die Notwendigkeit der Veränderung aufzeigen, nicht eine Verlängerung des immer weiter so. Solchen prophetischen Widerspruch brauchen die Kirchen heute auch. Und das passiert zum Beispiel, wo Christ:innen gegen repressive Abschiebungen Kirchenasyl organisieren, sich dem Kriegsdienst verweigern, Braunkohlezüge blockieren und in der Inflation Lebensmittel klauen und sie dann verschenken. So das Christ:in-Sein zu leben ist glaubhaft, das stimmt nicht ein in die Hoffnungslosigkeit der Religion des Marktes, der wir irgendwie doch angehören in dieser Warengesellschaft.
Interview: Ulla Fricke